Organisation des Patentmanagements
Die IP-Kapazitäten können grundsätzlich auf vier Arten strukturiert werden. Zum einen kann eine Stabsstelle oder eine Stabsabteilung geformt werden. Zum anderen können die IP-Kapazitäten auf die einzelnen technologischen Geschäftsbereiche verteilt werden. Zum dritten kann eine externe IP-Abteilung gebildet werden. Außerdem können externe Patentanwälte genutzt werden.
Sie benötigen weitere Informationen zum Führen eines Unternehmens:
Unternehmen
Stabsabteilung
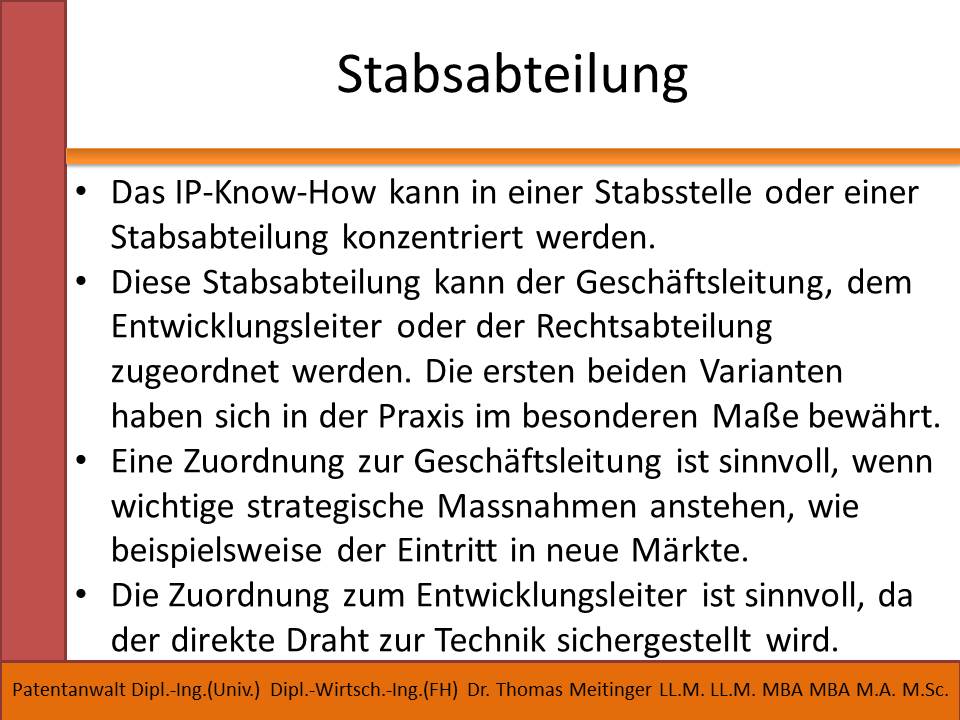
Das IP-Know-How kann in einer Stabsstelle oder einer Stabsabteilung konzentriert werden. Diese Stabsabteilung kann der Geschäftsleitung, dem Entwicklungsleiter oder der Rechtsabteilung zugeordnet werden. Die ersten beiden Varianten haben sich in der Praxis im besonderen Maße bewährt. Eine Zuordnung zur Geschäftsleitung ist sinnvoll, wenn wichtige strategische Massnahmen anstehen, wie beispielsweise der Eintritt in neue Märkte. Die Zuordnung zum Entwicklungsleiter ist sinnvoll, da der direkte Draht zur Technik sichergestellt wird.
Integriert in Geschäftsbereiche
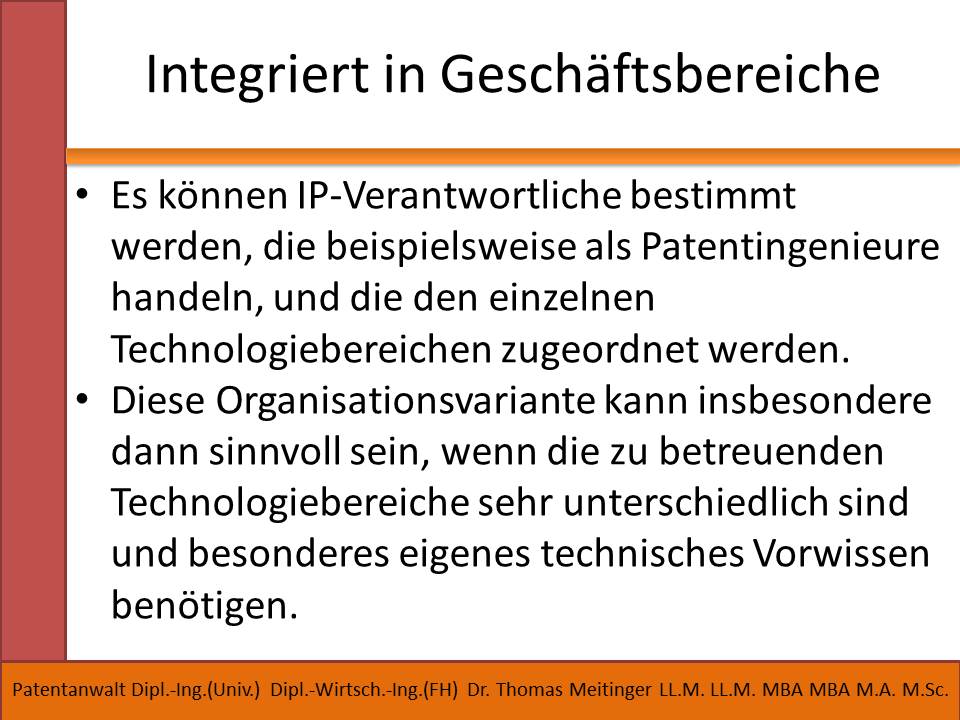
Es können IP-Verantwortliche bestimmt werden, die beispielsweise als Patentingenieure handeln, und die den einzelnen Technologiebereichen zugeordnet werden. Diese Organisationsvariante kann insbesondere dann sinnvoll sein, wenn die zu betreuenden Technologiebereiche sehr unterschiedlich sind und besonderes eigenes technisches Vorwissen benötigen.
Externe Technologiegesellschaft
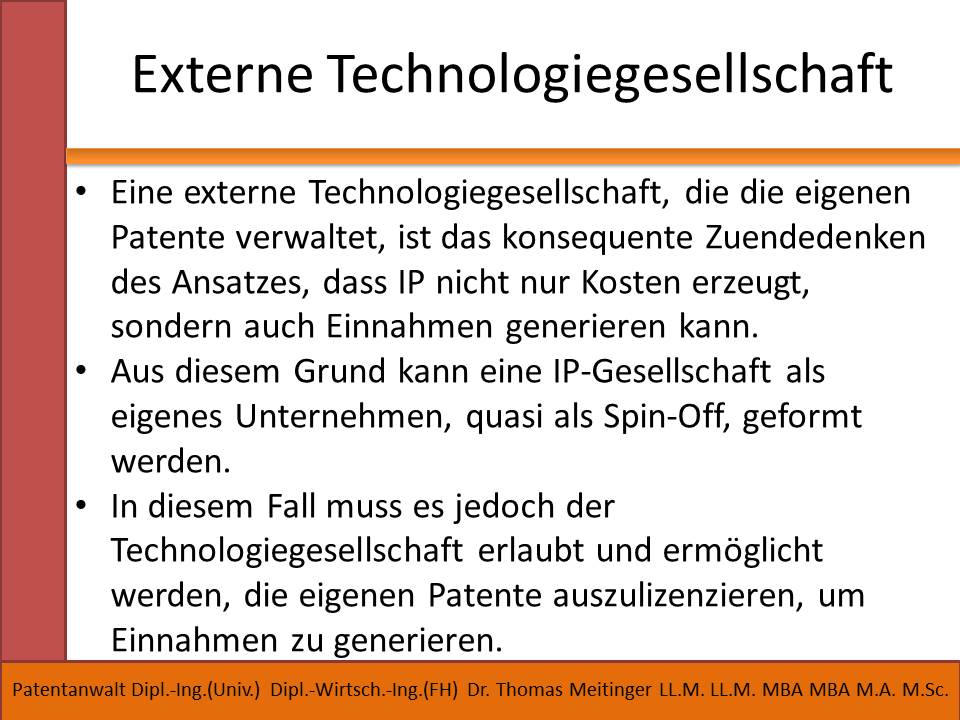
Eine externe Technologiegesellschaft, die die eigenen Patente verwaltet, ist das konsequente Zuendedenken des Ansatzes, dass IP nicht nur Kosten erzeugt, sondern auch Einnahmen generieren kann. Aus diesem Grund kann eine IP-Gesellschaft als eigenes Unternehmen, quasi als Spin-Off, geformt werden. In diesem Fall muss es jedoch der Technologiegesellschaft erlaubt und ermöglicht werden, die eigenen Patente auszulizenzieren, um Einnahmen zu generieren.
Externe Patentanwälte
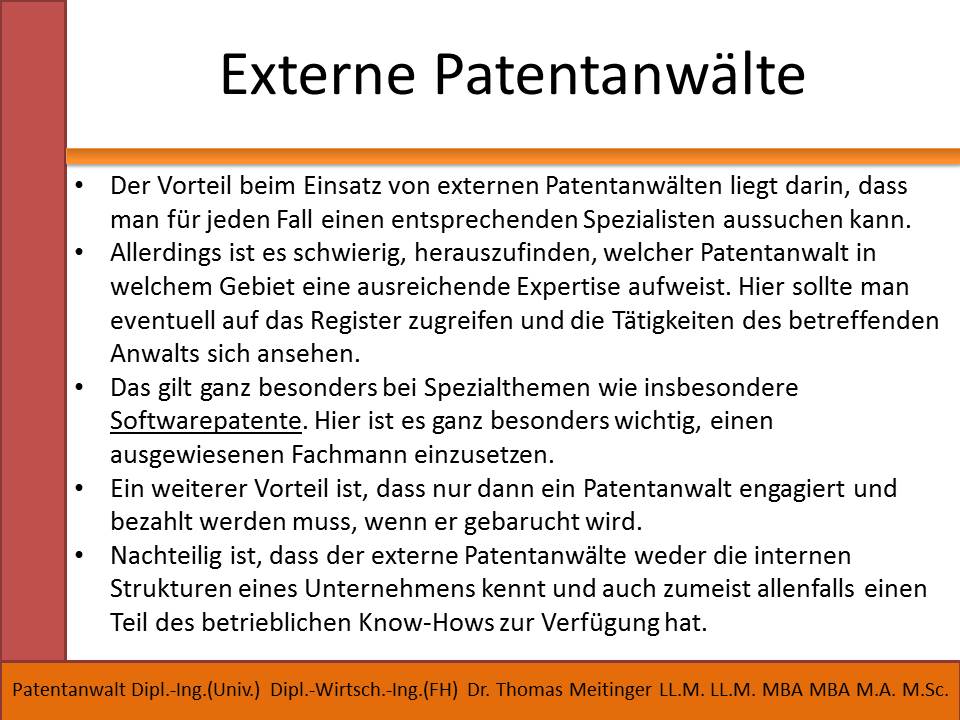
Der Vorteil beim Einsatz von externen Patentanwälten liegt darin, dass man für jeden Fall einen entsprechenden Spezialisten aussuchen kann. Allerdings ist es schwierig, herauszufinden, welcher Patentanwalt in welchem Gebiet eine ausreichende Expertise aufweist. Hier sollte man eventuell auf das Register zugreifen und die Tätigkeiten des betreffenden Anwalts sich ansehen. Das gilt ganz besonders bei Spezialthemen wie insbesondere Softwarepatente. Hier ist es ganz besonders wichtig, einen ausgewiesenen Fachmann einzusetzen. Ein weiterer Vorteil ist, dass nur dann ein Patentanwalt engagiert und bezahlt werden muss, wenn er gebarucht wird. Nachteilig ist, dass der externe Patentanwälte weder die internen Strukturen eines Unternehmens kennt und auch zumeist allenfalls einen Teil des betrieblichen Know-Hows zur Verfügung hat.
Zurück